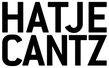| Sprache: |
Der (im-)perfekte Mensch
Vom Recht auf Unvollkommenheit
€ 19,80
inkl. MwSt.
Versandkosten werden
beim Checkout berechnet
Herausgegeben von: Deutsches Hygiene-Museum Dresden, Aktion Mensch e.V.
Texte von: Dietmar Kamper, Detlef B. Linke, Peter Gorsen, Dieter Mattner, Dietmar Mieth, Peter Sloterdijk, Heike Zirden u.a.
Vorwort von: Prof. Dr. Dieter Stolte, Klaus Vogel, Dr. Gisela Staupe
Deutsch
Januar 2001, 264 Seiten, 126 Fotos
Broschur
165mm x
240mm
ISBN:978-3-7757-0997-2
Ausstellung: Deutsches Hygiene-Museum, Dresden 20.12.2000- 12.8.2001, Martin-Gropius-Bau, Berlin 16.03.-02.06.2002 Wer ist schön? Wer ist hässlich? Wer ist gesund? Wer ist krank? Der Biotechnologie-Boom und die Machbarkeitsfantasien, die er auslöst, erhöhen den gewaltigen gesellschaftlichen Normierungsdruck, der ohnehin auf jedermann lastet: »Normal« oder noch besser, »perfekt« zu sein, erscheint zunehmend erstrebenswert. Obwohl alle betroffen sind, lässt sich anhand der großen Gruppe von Menschen mit Behinderungen besonders klar veranschaulichen, welche Funktionen und welche Folgen diese je nach historischer Machtsituation verschiebbaren Normen haben. Die Aggressivität und Lebensfeindlichkeit, die sich hinter nur scheinbar wertfreien Idealen wie Ästhetik, Gesundheit oder Rationalität verbergen, werden in dieser Publikation anhand von Aufsätzen namhafter Fachleute und von Biografien behinderter Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart deutlich. Sich den von den Medien propagierten Leitbildern menschlicher Perfektion zu entziehen, stellt einen ersten Schritt zu sozialer Mündigkeit dar. Ausstellung und Publikation wollen Denkanstöße dazu geben.
»Immer häufiger finden sich in Wohnungen Nachbauten der Möbel etwa von Le Corbusier oder Eileen Gray. In Theaterfoyers, Bankenvorhallen und Politikerbüros begegnet man Nachbauten von Ludwig Mies van der Rohe und Marcel Breuer. Design-Klassiker, insbesondere aus der Bauhaus-Zeit, haben Kultstatus erreicht. Wer einen »Klassiker« kauft, sucht ein Produkt, das Standards setzt, ein Produkt, das vom Nimbus der Avantgarde umgeben ist und von ewiger Gültigkeit zu sein scheint. Früher hat sich ein Möbelstück erst nach jahrelangem Gebrauch als zeitlos, als Klassiker erwiesen. Heute dagegen werden von den Herstellern mit Hilfe immer neuer Strategien Möbel in den Status des Modernen Klassikers erhoben, die dann in hochpreisigen autorisierten Re- Editionen, aber auch als einfache, häufig auch verfälschte Billigkopien weite Verbreitung finden. Eine ganze Industrie lebt - in Ermangelung echter neuer Trends - von diesem Retro-Trend. Die Gesellschaft findet hierin eindeutige Distinktionssymbole innerhalb eines schnellen Wandels und zunehmenden Individualismus. Die Autorin geht in ihrer Studie den Phänomenen und Vermarktungsstrategien dieses aktuellen Prozesses anhand der sprechendsten Beispiele - etwa dem Eames-chair oder der Liege LC 4 von Le Corbusier - und den bekanntesten Produzenten wie Alessi, Cassina, Ikea, Knoll, Manufaktum, Thonet und Vitra nach.«

Gerda Breuer
Buchempfehlungen